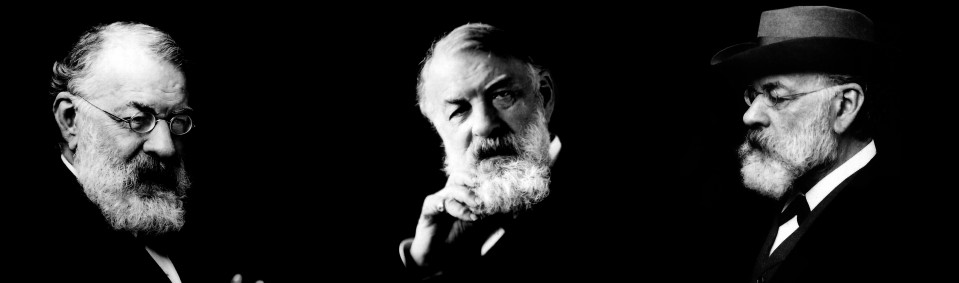Joseph Joachim and Andreas Moser, Violinschule, vol. 3 (Vortragstudien), Berlin: N. Simrock, 1905, pp. 228-231.


Konzert in E moll, op. 64
von
Felix Mendelssohn-Bartholdy
(geb. 1809 in Hamburg, gest. 1847 in Leipzig)
 ls Sechzehnjähriger hatte ich wiederholt das Glück, dieses Konzert vom Komponisten begleitet zu spielen, dessen Intentionen mir somit genau vertraut sind, da er es an gelegentlicher Kritik nicht fehlen ließ.
ls Sechzehnjähriger hatte ich wiederholt das Glück, dieses Konzert vom Komponisten begleitet zu spielen, dessen Intentionen mir somit genau vertraut sind, da er es an gelegentlicher Kritik nicht fehlen ließ.
Wie eine zarte Klage hebt das Hauptmotiv an, das mit innerlicher Erregung, aber piano vorzutragen ist. Man vermeide jedoch zu aufdringliche Accente, wenn auch zarte Wellenlinien des Stärkegrades am Platze sind. Wollte man diese durch Vortragszeichen andeuten, dürfte der Ausdruck leicht zu materiell werden. Erst das Crescendo führt zu dem feurig einzusetzenden Auftakt vor den leidernschaftlich erregten Triolengruppen, die dann, stetig auf- und abwogend, zum Fortissimo des Hauptmotivs führen, mit dem das Tutti einfällt. Die Schwellungen in dem aus diesem Tutti übernommenen Nebenmotiv sind heftig wiederzugeben und die dreimal wiederkehrenden dreitaktigen, ab- und aufsteigenden Achtelstellen mit großem Ton und breiten Strichen ohne Hast zu spielen. Alle anschließenden Episoden, die zum zweiten Thema führen, mit andauernd belebtem Zug, unter gewissenhafter Beobachtung der mannigfachen dynamischen Bezeichnungen des hinab- und hinaufstürzenden Passagenwerkes. Man hüte sich aber dabei vor einem Überhetzen des bewegten Treibens, in das man leicht bei diesem Satz zu seinem Nachteil verfällt. — Sechs Takte vor dem piano tranquillo beruhige man allmählich, aber sehr unmerklich, das Zeitmaß, um das zweite Hauptthema mild-tröstlich einzusetzen. Das tranquillo bei den absteigenden Dreiklangeschritten darf aber ja nicht in ein starkes ritardieren ausarten, mit dem belastet man es leider nur allzu häufig hört. Eine wesentliche Tempoveränderung beim G dur-Motiv, die bis zur Aufhebung der Alla breve-Empfindung führte, wäre in direktem Gegensatz zum Wunsch des Komponisten. Denn er, der so meisterlich in elastischer Handhabung des Zeitmaßes Ausdrucksnüancen zu vermitteln verstand, wollte stets die Einheitlichkeit des Tempo eines Satzes im ganzen gewahrt wissen. Auch beim Ausklingen der Melodie nach dem Halt auf dem hohen Flageolet-A hüte man sich vor einem zu starken ritardando. (Es ist ein oft vorkommender Mißbrauch, letzteres bis zur Aufhebung des Rhythmus zu übertreiben, gewissermaßen Allegro und Adagio unvermittelt nebeneinander zu stellen.) In frischem Zug führe man das Solo zu Ende, mit schöner Steigerung, aber immer charaktervoll das Tempo festhaltend. — Bei der Durchführung, die nach den vier, vom Orchester hineingeworfenen Zwischentakten beginnt, lasse man das tranquillo, in feinsinniger Berücksichtigung der Verkleinerung des vorangehenden, sich nun in legato-Achtel verwandelnden Motivs, anfangs weich und ausdrucksvoll erklingen. Vom sempre pianissimo an verzögere man ganz unmerklich das Zeitmaß. Die Kadenz, welche als integrierender Teil des Satzes, als ein großzügiges Ganzes gedacht ist, darf sich nicht in kleine Details auflösen. Die sie einleitenden Arpeggien müssen mit langen Bogenstrichen gespielt werden, die anschließenden gebrochenen Akkorde brilliant aufwärtsstrebend, aber ja nicht etwa bis zu einem piano auf dem höchsten gehaltenen Ton abnehmend, wie man sie oft zu hören kriegt! Eine Ausnahme dürfte höchstens die Fermate auf dem hohen E machen. Von den Trillerketten ab rüstig vorwärts, namentlich in den Takten unmittelbar vor der Fermate. Darauf legte der Komponist besonderes Gewicht. Und nun, von den anfangs breit auftretenden aber mit einer gewissen improvisatorischen Freiheit zu behandelnden Arpeggien, vermittle man den Übergang vom festen Strich zum springenden, vom forte zum pianissimo, und von langsamer zu schnellerer Bewegung so, daß das Grundzeitmaß des Satzes einen Takt vor Eintritt des Hauptthemas im Orchester feststeht. Eine schwierige Aufgabe, aber des Fleißes wert! — Für das nun Folgende gilt das bereits früher Gesagte. Namentlich ist bei allem Feuer im più presto auf charaktervoll bewußte Beschleunigung ohne überstürzung und auf markige Tongebung auch im äußersten Presto zu halten.
Über den Charakter des lieblich fließenden Gesanges im Andante ist kaum mehr zu sagen, als daß er nicht schlicht genug wiedergegeben werden kann. Alles übermäßige Vibrieren, alles süßliche Hinüberziehen von einem Ton zum andern wird sich demjenigen, der seinen keuschen Reiz empfindet, von selbst verbieten. Auf sorgfältige dynamischen Schattierung zumeist kommt es da an, und auf schönes Verhallen z. B. im 17. Und 18. Takt der langatmig schönen Melodie. Technisch nicht leicht auszuführen ist die unabhängig und tonvoll zu den Zweiunddreißigsteln zu singende Mollmelodie, deren Sechzehntel in schönem legato erklingen müssen, nicht etwa als kurze Zweiunddreißigstel. Das will sorgfältig erübt sein! — Bei der überleitung ins erste Thema suche man die Wirkung des Wiedereintrittes der ersten Melodie durch ein fein angelegtes, ins pianissimo aushauchendes Diminuendo zu erreichen, nicht durch ein ritardando; höchstens durch eine kaum fühlbare Verzögerung. Der Reiz liegt gerade in dem Hineingleiten und unvermuteten Auftauchen. Die Hörer sollen bei solchen Stellen nicht erst durch ein “Seht, jetzt kommt’s!” darauf aufmerksam gemacht werden.
Einer der gewinnendsten Züge in diesem an Schönheiten so reichen Werk, gegen deren volle Würdigung manche vielleicht durch zu häufige Vorführung abgestumpft scheinen, ist die Überleitung vom Andante zum Finale mittelst des empfindungswarmen echt Mendelssohnschen Arioso. Man beachte beim Vortrag besonders den plötzlichen, freudigen Aufschwung des molto crescendo und wiederhole nicht etwa im achten Takt die Fermate, die nur im vierten am Platze ist!
Für das sprühende, frische Finale sei zunächst bemerkt, daß der Autor das Tema nicht mit fliegendem staccato, sondern zwar leicht, aber mit spitzem Ton, kurz und prickelnd wiedergegeben wünschte. Der fliegende Bogenstrich erschien ihm zu weich und flocking. Manchem wird die gewollte Art der Ausführung schwierig werden, wie denn überhaupt das Finale große Ansprüche an behende Führung des Bogens und geläufige Geschmeidigkeit der Finger stellt. Der dritte Takt des Hauptmotivs sei bsonders leicht und neckisch behandelt, so oft er im Verlauf wiederkehrt. In das Tutti muß sich der vorangehende Lauf nach wohlangelegtem Crescendieren der langen Sechzehntel-Passage mit großer Bravour hineinschwingen. Das H dur-Motiv präge man scharf rhythmisch aus, auch im piano, und versaume nicht, die beiden auf das letzte Viertel des 7., 8. und 9. Taktes fallenden Achtel besonders kurz zu gestalten, was für den Ausdruck der ganzen Stelle wichtig ist. Die beiden Schlußtakte (semplice) müßen der Vorschrift entsprechend anmutig, unpretentiös auftreten. Im engsten Anschluß an die reizvolle Durchführung des zweiten Hauptmotivs in der Orchesterbegleitung behandle der Solist die mit Springbogen wiederzugebenden Sechzehntel, welche es tändelnd umspielen, metronomisch genau; vor dem pizzicato steigere er sie zur Brillanz. Unbeugsame Straffheit im Zeitmaß bei noch so großer Lebendigkeit des Vortrags charakterisiere auch die folgende, in G dur beginnende Durchführung des Hauptmotivs mit den in der Begleitung reizvoll hinzutretenden Melismen. Nicht zu vergessen das senza ritardare vor dem Wiedereintritt des E dur! In der Koda wird der nach dem langen Triller auf E folgende — von Mendelssohn eingestandenermaßen dem Virtuosen H. W. Ernst abgelauschte Sprung zum hohen cis dem Vortragenden von selbst zu feurigstem Schwung heraufordern. Mit großem Ton und auch in den tiefen Oktaven anhaltendem Feuer gespielt, werden die darauffolgenden Gänge als Klimax unfehlbare Wirkung ausüben.
J. J.